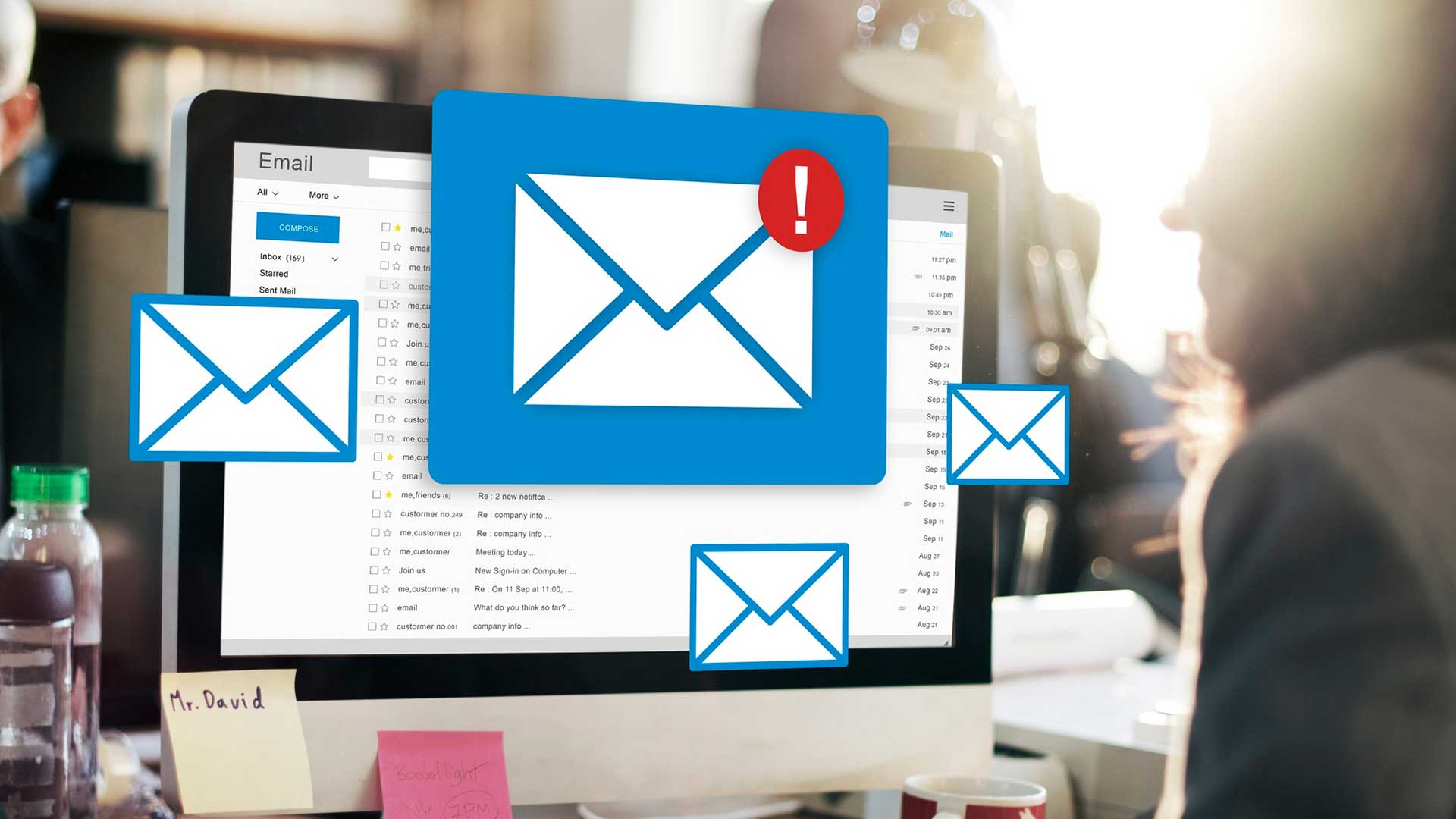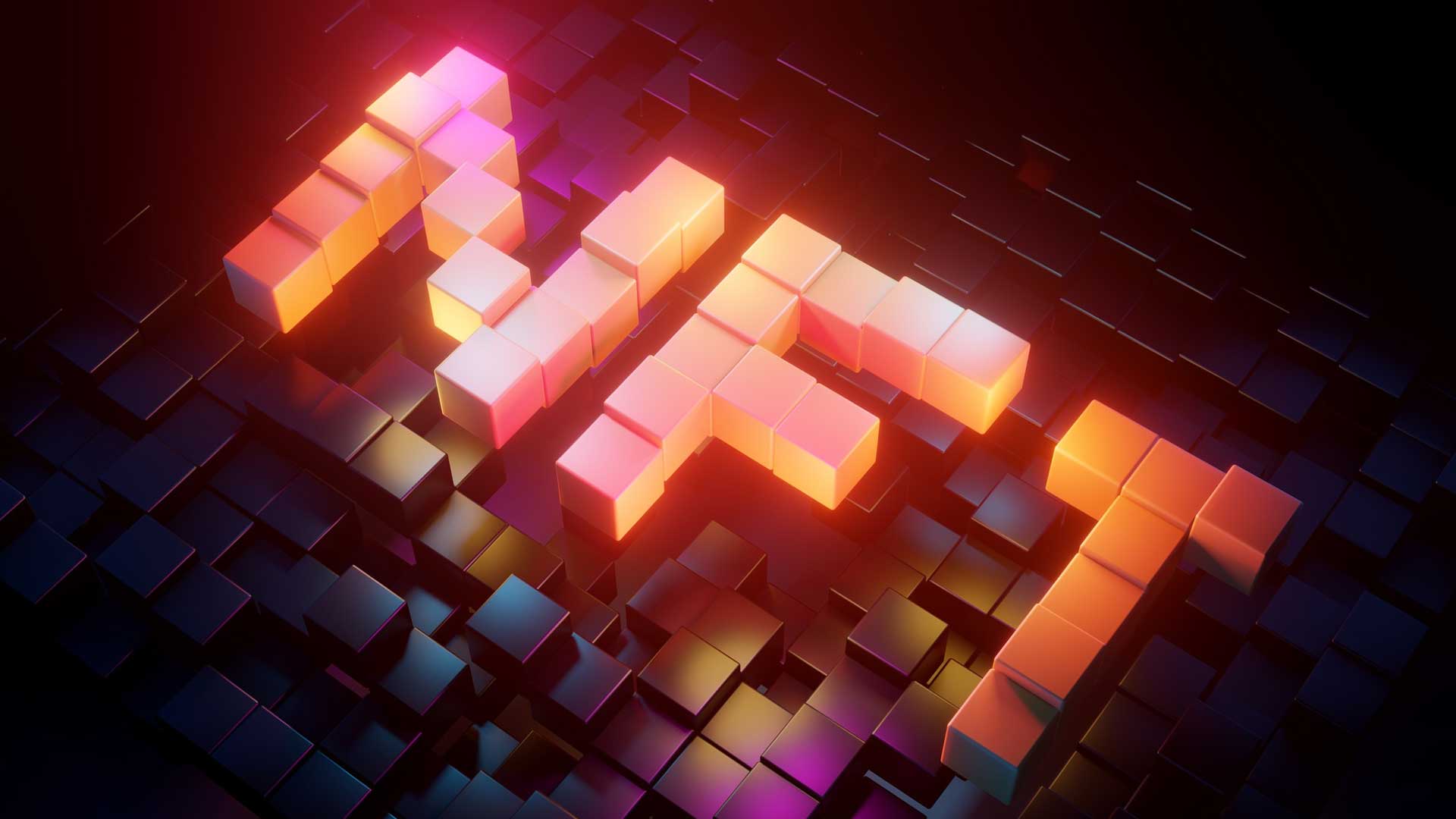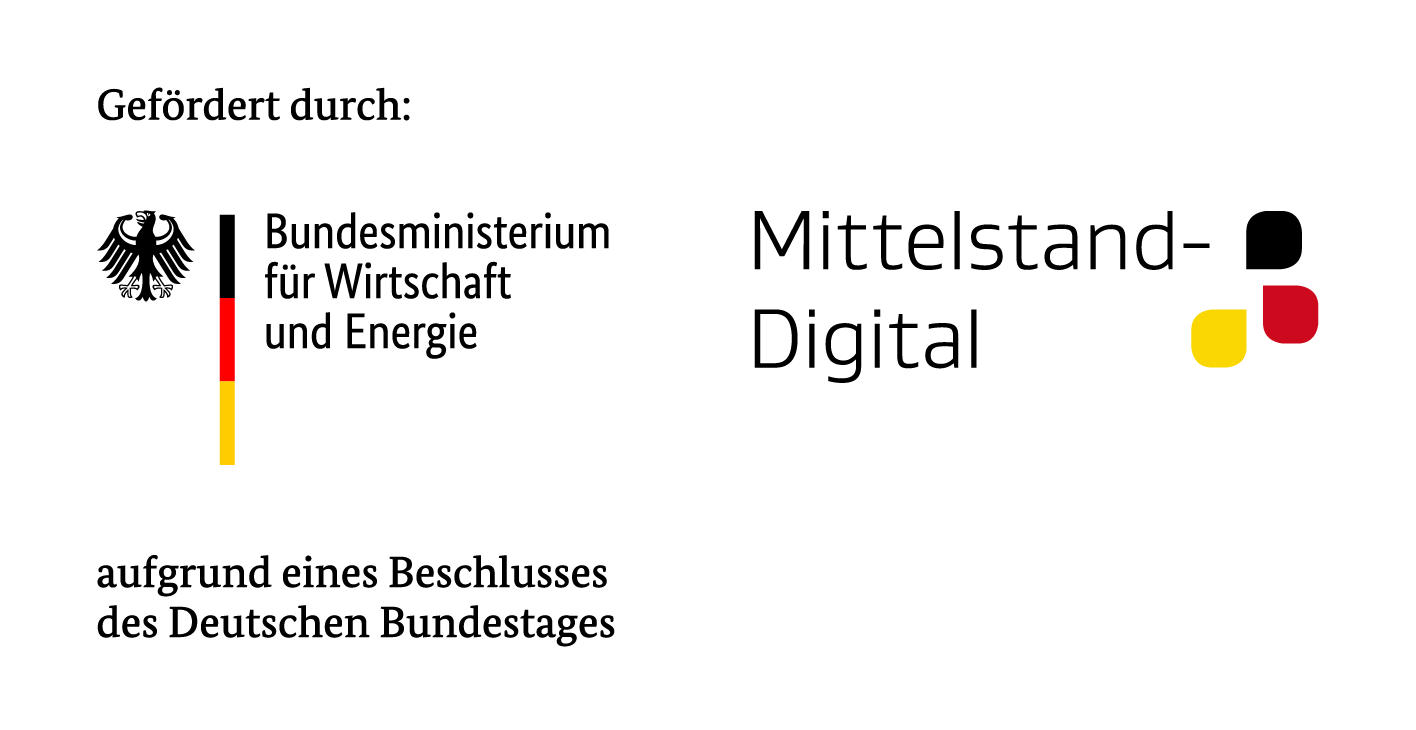Was ist Guerilla-Marketing?
Guerilla-Marketing ist besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) attraktiv: Mit wenig Budget werden kreative, überraschende Werbeformen eingesetzt, um große Aufmerksamkeit zu erzielen.
Die Bezeichnung Guerilla ist für untypische Kriegstaktiken bekannt, die die Gegner aus dem Hinterland überraschen. Auch die Grundidee des Guerilla-Marketings ist es, überraschend, rebellisch und ansteckend zu sein, um mit wenig Aufwand eine große Anzahl von Personen zu bewegen. Die Maßnahmen wirken oft im öffentlichen Raum oder online – genau dort, wo klassische Werbung heute weniger beachtet wird.
Doch gerade diese unkonventionelle Herangehensweise wirft rechtliche Fragen auf – insbesondere im Wettbewerbsrecht, Urheberrecht und Datenschutzrecht. Diese Wissensbox liefert einen Überblick zu den wichtigsten rechtlichen Rahmenbedingungen.
Guerilla-Marketing im Lichte des Wettbewerbsrechts (UWG)
Auch kreative Werbemaßnahmen unterliegen rechtlichen Grenzen. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) setzt dabei den zentralen Rahmen – insbesondere wenn Werbung provoziert, übertreibt oder gezielt Aufmerksamkeit erzeugt.
§ 4 UWG – Unlauteres Verhalten im Wettbewerb
§ 4 UWG bildet eine Generalklausel, die unlautere geschäftliche Handlungen verbietet. Sie fordert insbesondere die Beachtung der beruflichen Sorgfalt und schützt sowohl Verbraucher als auch Mitbewerber. Für KMU bedeutet das: Auch kreative und provokante Werbung muss ethisch vertretbar, sorgfältig vorbereitet und rechtlich zulässig sein.
Viele Guerilla-Aktionen arbeiten mit bewussten Grenzüberschreitungen, etwa durch Übertreibung, Tabubruch oder das Erzeugen von Empörung. Solche Maßnahmen können als Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten gewertet werden, insbesondere wenn sie gesellschaftlich sensible Themen instrumentalisieren, emotionale Ausnahmesituationen ausnutzen oder gezielte Überrumpelung und Schockeffekte einsetzen.
Empfehlung für KMU: Werbemaßnahmen sollten im Vorfeld auf ihre Wirkung geprüft werden. Provokation ist erlaubt, darf aber nicht in Rufschädigung, Angstwerbung oder Grenzüberschreitungen münden.
§ 5 UWG – Irreführende Werbung
Ein Verstoß gegen § 5 UWG liegt vor, wenn Werbung unwahre oder irreführende Angaben enthält, die geeignet sind, um die Kaufentscheidung der angesprochenen Verbraucher zu beeinflussen. Guerilla-Kampagnen setzen häufig auf Verfremdung, Ironie oder Überraschung – gerade hier besteht die Gefahr, dass Aussagen nicht eindeutig als Werbung erkennbar oder missverständlich sind.
Beispielhafte Risiken umfassen: vermeintliche Nachrichtenmeldungen („Fake News“), Scheinangebote (Lockvogelwerbung) oder versteckte Markenbotschaften, die als unabhängige Information erscheinen. Werbung muss auch bei künstlerischer Gestaltung klar als solche erkennbar sein und darf keine falschen Erwartungen wecken.
Hinweis: Laut BGH (Urteil vom 27.06.2024, I ZR 98/23) darf z. B. mit Begriffen wie „klimaneutral“ nur geworben werden, wenn der zugrundeliegende CO₂-Ausgleich oder die Reduktion transparent erläutert ist. Fehlt diese Information liegt eine irreführende Werbung vor.
§ 6 UWG – Vergleichende Werbung
Vergleichende Werbung ist grundsätzlich erlaubt – aber nur, wenn sie sachlich, wahr und objektiv überprüfbar ist. Ziel ist es, den Wettbewerb zu fördern, nicht den Mitbewerber zu verunglimpfen.
Gerade Guerilla-Marketing-Kampagnen greifen oft zu ironischen oder spöttischen Darstellungen anderer Marken. Diese überschreiten schnell die rechtlichen Grenzen, insbesondere wenn der Vergleich nicht belegbar ist oder die Konkurrenz lächerlich gemacht wird.
Für KMU relevant: Schon der indirekte Verweis auf Wettbewerber („anders als bei XY“) kann problematisch sein, wenn keine überprüfbaren Tatsachen angegeben werden. Auch die Nutzung fremder Marken oder Logos – selbst in abgewandelter Form – birgt markenrechtliche Risiken.
§ 7 UWG – Unzumutbare Belästigung
§ 7 UWG schützt Verbraucher vor aufdringlicher oder unerwünschter Werbung. Eine unzumutbare Belästigung liegt insbesondere dann vor, wenn Werbemaßnahmen ohne ausdrückliche Einwilligung erfolgen – z. B. per Telefon, E-Mail, SMS oder Messenger-Dienst.
Auch physische Guerilla-Aktionen wie unangekündigte Flashmobs können als belästigend gelten, wenn sie Passanten bedrängen oder überrumpeln.
Rechtliche Besonderheiten im digitalen Raum
Digitale Kanäle bieten große Reichweite für Guerilla-Kampagnen – bergen aber ebenso große rechtliche Risiken. Besonders Verbraucherschutz, Urheberrecht und Datenschutz stehen hier im Fokus.
Kennzeichnungspflicht: Werbung muss erkennbar sein (§ 5a Abs. 6 UWG)
Insbesondere in sozialen Medien dürfen Werbeinhalte nicht als neutrale Inhalte erscheinen. Auch Posts von Influencern, Verlosungen oder Memes mit Werbezweck müssen als Werbung kenntlich gemacht werden – etwa durch Hashtags wie #Anzeige oder #Werbung.
Fake-Kampagnen: Gefahr der Irreführung (§ 5 UWG)
Täuschende Inszenierungen wie fingierte Skandale, scheinbar spontane Vorfälle oder erfundene Produkte können gegen das Irreführungsverbot verstoßen, wenn sie die geschäftliche Entscheidung der Zielgruppe beeinflussen.
Urheber- und Markenrecht gelten auch im Netz
Die Verwendung fremder Inhalte – etwa Bilder, Musik, Logos oder Videos – ist nur mit entsprechender Zustimmung zulässig. Besonders Remix-Inhalte oder Parodien mit erkennbaren Markenbezügen sind heikel.
Datenschutz & Bildrechte (DSGVO, § 22 KUG)
Bei Videoaktionen, Selfie-Kampagnen oder Fotoveröffentlichungen im öffentlichen Raum ist zu prüfen, ob Personen identifizierbar sind. In diesem Fall ist eine ausdrückliche, dokumentierte Einwilligung erforderlich.
Plattform-AGB: Regeln der Anbieter beachten
Viele soziale Plattformen untersagen bestimmte Werbeformate – z. B. politische Parodien, aggressive Challenges oder manipulative Clickbait-Kampagnen. Ein Verstoß gegen die AGB kann zur Sperrung von Inhalten oder Accounts führen.
Hinweis: Plattform-AGB ändern sich regelmäßig – aktuelle Vorgaben sollten vor jeder Kampagne geprüft werden.
Fazit
Guerilla-Werbung kann für KMU ein kraftvolles Mittel zur Markenbildung und Kundengewinnung sein. Doch je kreativer die Idee, desto größer das rechtliche Risiko – besonders im Wettbewerbs- und Datenschutzrecht. Wer frühzeitig juristischen Rat einholt, die Kampagne interdisziplinär plant und die relevanten Gesetze beachtet, kann originelle Maßnahmen erfolgreich und rechtssicher umsetzen.