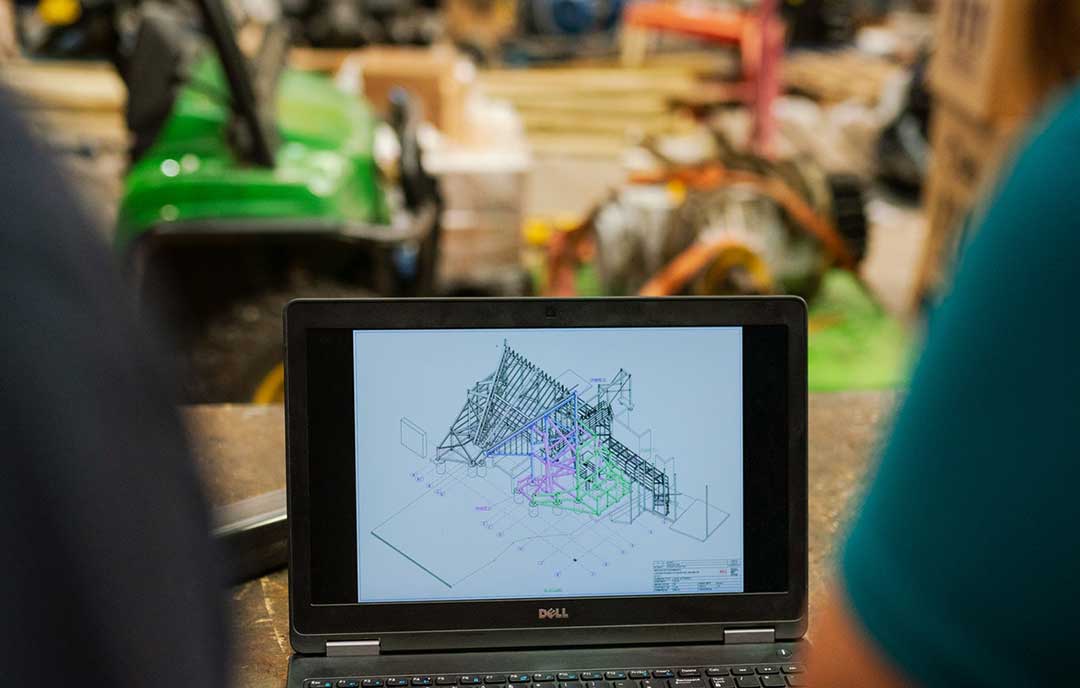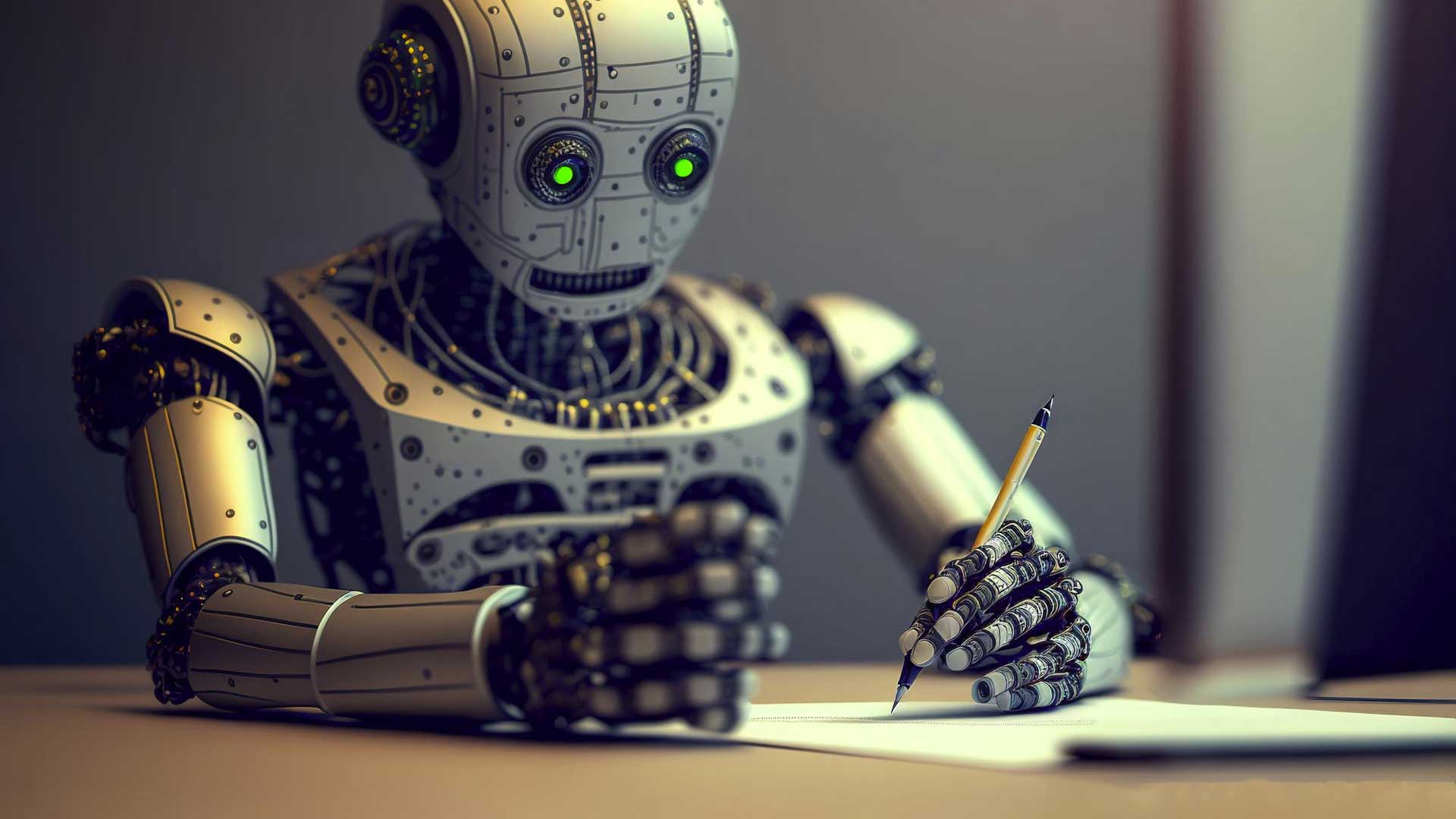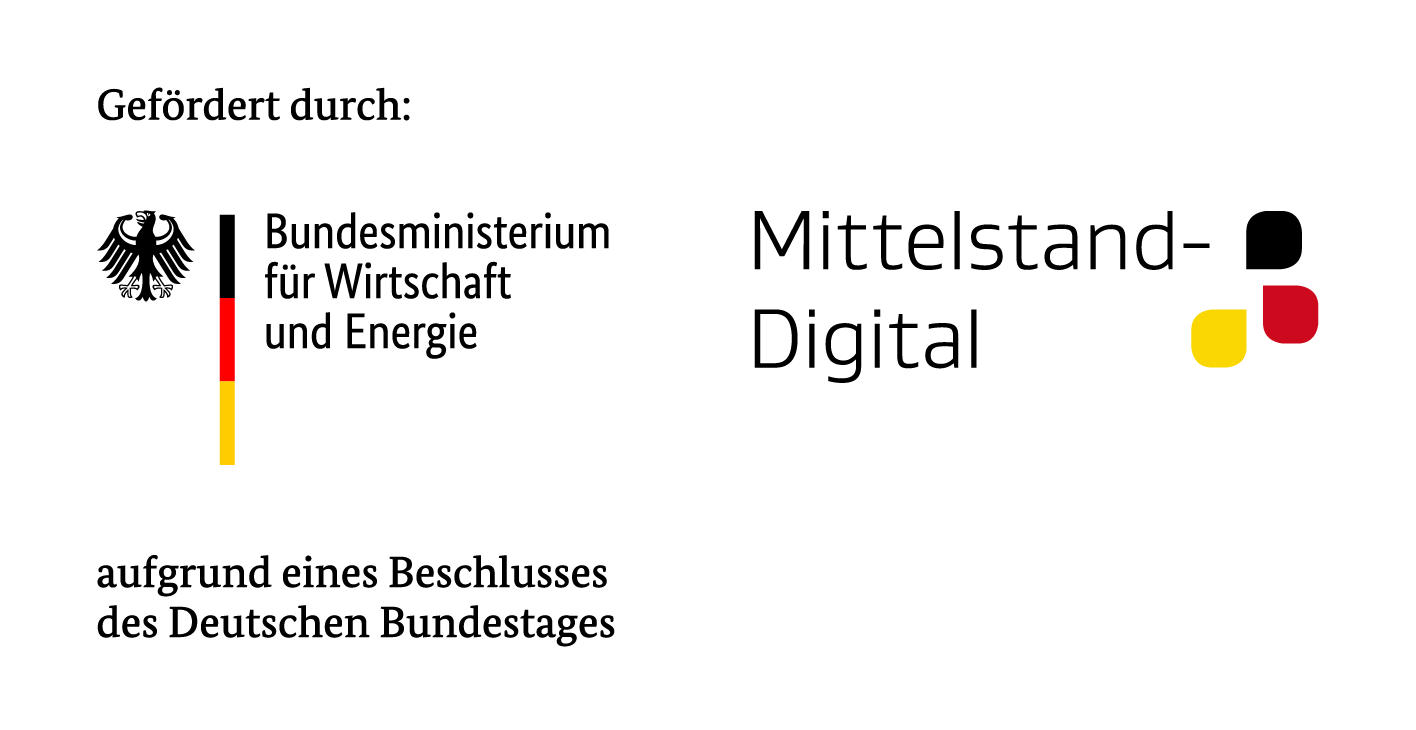Die Europäische Union verfolgt das Ziel, Innovation und Forschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) nachhaltig zu fördern und Europa als KI-Standort weiterzuentwickeln. In unserem Beitrag beleuchten wir das Forschungsprivileg der KI-Verordnung (KI-VO) und zeigen dessen Grenzen und die damit verbundenen Herausforderungen auf (Abschnitt I). Außerdem stellen wir die Einrichtung und Nutzung von Reallaboren als Maßnahmen vor, die darauf abzielen, die Herausforderungen für die Praxis zu bewältigen und den Transfer von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft zu fördern.
Das Forschungsprivileg der KI-Verordnung
Die KI-VO stellt einen Meilenstein in der Regulierung von KI in der Europäischen Union dar. Umfassende produktsicherheitsrechtliche Anforderungen können jedoch in der Entwicklungsphase von KI-Anwendungen durchaus innovationshemmend wirken, was die KI-Forschung insgesamt ausbremsen kann. Um dem entgegenzuwirken, schreibt die KI-VO zum einen ausdrücklich fest, dass trotz der weitreichenden Pflichten und Einhaltung ethischer und professioneller Grundsätze die Freiheit der Wissenschaft gewahrt und Innovation gefördert werden soll (ErwGr.[1] 25 KI-VO). Zum anderen legt sie fest, dass bei der Forschung und Entwicklung (F&E) die normativen Anforderungen erfüllt werden müssen. Die KI-VO formuliert insoweit ein (begrenztes) Forschungsprivileg.
Dieses nimmt KI-Systeme und -Modelle vom Anwendungsbereich der KI-VO aus, die ausschließlich zu wissenschaftlichen Forschungs- und Entwicklungszwecken entwickelt und betrieben werden (Art. 2 Abs. 6; ErwGr. 25). Praktisch bedeutet dies, dass Forschungsvorhaben im Labor von zahlreichen regulatorischen Anforderungen entbunden bleiben, solange die betreffenden Systeme nicht auf dem Markt in Verkehr gebracht oder unter realen Bedingungen eingesetzt werden. Ziel ist es, innovative Ansätze nicht bereits in der Entstehungsphase zu be- oder verhindern.

Das so ausgestaltete Forschungsprivileg führt jedoch insbesondere bei anwendungsorientierten Forschungsvorhaben zu Abgrenzungsfragen.
Zum einen kann die Unterscheidung zwischen reiner Forschung und marktorientierter Innovation in der Praxis schwierig sein. Ähnliche Probleme bestehen bei wirtschaftsorientierten Innovationsprojekten. Unter Umständen fallen diese, je nach konkreter Sachlage und Kontext, eben nicht unter das Forschungsprivileg. Zu Beginn von F&E-Projekten stehen oftmals weder Methoden noch Ziele der Forschung vollumfänglich fest. Dies erschwert eine frühzeitige selbstständige Überprüfung der Compliance mit der KI-VO und führt damit zu Rechtsunsicherheit.
Tests unter Realbedingungen nach der KI-VO (Art. 3 Nr. 57 KI-VO)
Die KI-VO sieht die Möglichkeit eines befristeten Tests unter Realbedingungen außerhalb herkömmlicher Labor- oder Simulationsumgebungen vor. Solche Tests sind zunächst auf sechs Monate angelegt, können jedoch um weitere sechs Monate verlängert werden (Art. 3 Nr. 57 KI-VO). Während dieser begrenzten Zeitspanne wird das KI-System gezielt auf seine zweckbestimmte Funktionstauglichkeit geprüft. Im Fokus steht dabei die Sammlung verlässlicher und belastbarer Daten, die einen realistischen Einblick in das Verhalten und die Leistungsfähigkeit der KI im späteren Anwendungsfeld erlauben. Ein zentrales Ziel ist zudem die Überprüfung der Konformität des KI-Systems mit den Anforderungen der KI-VO, um eine rechtskonforme und sichere Einführung in den Markt zu gewährleisten.
Zum anderen können sich im Entwicklungsverlauf zahlreiche Herausforderungen stellen, selbst wenn das avisierte Forschungsvorhaben grundsätzlich unter das Forschungsprivileg der KI-VO zu fassen ist. So fallen Testes unter Realbedingungen grundsätzlich nicht unter das Forschungsprivileg. Prototypen dürfen also nicht ohne Weiteres unter Realbedingungen erprobt werden. Dies kann erhebliche Herausforderungen für Forschende darstellen, da nicht jedes System ausschließlich mit synthetischen Trainingsdaten aus dem Labor entwickelt und getestet werden kann. Gerade für Hochrisiko-KI-Systeme ist es entscheidend, ihre Funktionsfähigkeit nicht nur im Labor, sondern unter tatsächlichen Praxisbedingungen zu erproben.

Schließlich bestehen Herausforderungen für KMU, die in der Forschung aktiv sind. Sie können Lösungen zwar zunächst unter dem Forschungsprivileg entwickeln, aber diese dann aber nicht außerhalb des Forschungskontextes einsetzen. Der Transfer wissenschaftlicher Ergebnisse in die Wirtschaft wird durch die engen Grenzen des Forschungsprivilegs in der KI-VO erschwert.

Reallabore
Um die dargestellten Herausforderungen zu adressieren, können in der Praxis sog. ‚Reallabore‘ genutzt werden. Als Reallabore werden unterschiedliche, oft ineinandergreifende Erprobungskonzepte wie Testinfrastrukturen, Living Labs oder geförderte Innovationsprojekte bezeichnet. Gemein ist den verschiedenen Konzepten, dass sie die Möglichkeit bieten, neue Technologien, Methoden und Anwendungen unter realitätsnahen Bedingungen zu testen und Erkenntnisse für die Praxis zu gewinnen. Auch in der KI-VO ist die Einrichtung sog. ‚KI-Reallabore‘ von staatlicher Seite vorgesehen (Art. 57 Abs. 1 KI-VO).
KI-Reallabore nach der KI-Verordnung
Das europäische AI-Office wird künftig eine öffentlich einsehbare Liste aller KI-Reallabore nach der KI-VO in der Europäischen Union führen (Art. 57 Abs. 15 KI-VO). In diesen Testumgebungen können insbesondere Hochrisiko-KI-Systeme unter Realbedingungen und in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Marktüberwachungsbehörde erprobt werden. Dies ermöglicht die kooperative Vorbereitung der zukünftigen Konformitätsbewertung. Ziel der KI-Reallabore ist es auch, die Kooperation zwischen privaten und öffentlichen Akteuren zu stärken. Im Vorfeld der Testaktivitäten wird durch die nationale Behörde und beteiligte Akteure (z. B.: Anbieter des Systems, u. U. zukünftige Betreiber etc.) gemeinsam festgelegt, unter welchen Anforderungen und Bedingungen die Tests erfolgen sollen und dürfen. Gleiches gilt auch für die Auswahl von Schutzvorkehrungen für Grundrechte, Gesundheit und Sicherheit beteiligter oder betroffener Personen.
Die konkrete Ausgestaltung der KI-Reallabore wird die EU-Kommission zukünftig über Durchführungsrechtsakte genauer regeln (Art. 58 Abs. 1 KI-VO). Noch auszugestalten sind beispielsweise die Voraussetzungen und Auswahlkriterien für eine Beteiligung, die Verfahren für die Antragstellung, Überwachung und Beendigung des KI-Reallabors, einschließlich der Erstellung des Plans und des Abschlussberichts. Das nach der KI-VO von der nationalen Behörde (in Deutschland voraussichtlich die Bundesnetzagentur) zu schaffende ‚KI-Reallabor ist spätestens bis zum 2. August 2026 einzurichten. Zu diesem Zeitpunkt werden die genannten Ausgestaltungen in Form von Durchführungsrechtsakten voraussichtlich erlassen worden sein.
Auch national wurde bereits mit der Vorbereitung der KI-Reallabore begonnen. Ein spannendes Pilotprojekt unter der Leitung des Digitalministeriums Hessen, der Bundesnetzagentur und der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit simuliert aktuell die Abläufe eines KI-Reallabors gemäß KI-VO anhand von konkreten Fällen teilnehmender Unternehmen. Ziel ist es, zentrale Anforderungen und Herausforderungen unter realitätsnahen Bedingungen zu erproben und so wertvolles Wissen für den späteren Aufbau von KI-Reallaboren zu generieren. Bis Ende 2025 sollen konkrete Erkenntnisse zu Bedarfen, Ressourcen und offenen Fragen rund um KI-Reallabore vorliegen.
Reallabore nach nationalem Recht
Neben den KI-Reallaboren auf europarechtlicher Grundlage bestehen nationale Bestrebungen zur Förderung von Innovation durch die rechtssichere Einrichtung und Ausgestaltung von Reallaboren.
Reallabore-Gesetz-Entwurf: Innovationsfreundlicher Rahmen auf nationaler Ebene
In Deutschland wird zurzeit mit dem Reallabore-Gesetz-Entwurf (Reallabore-Gesetz-E) ein innovationsfreundlicher Rahmen für die Durchführung von Reallaboren geschaffen. Ziel ist es, die Möglichkeit zu eröffnen, innovative Technologien, Produkte, Dienstleistungen oder neue Ansätze gezielt in einem geschützten Experimentierraum zu erproben. Zugleich soll regulatorisches Lernen gefördert werden.
Regulatorisches Lernen (§ 2 Nr. 3 Reallabore-Gesetz-E)
Der Begriff des ‚regulatorischen Lernens‘ beschreibt dabei einen Prozess, in dem Erkenntnisse aus den Reallaboren genutzt werden, um bestehende Gesetze und Vorschriften z. B. zur Zulassung von KI-Anwendungen (auch auf Probe) anzupassen und zu verbessern.
Im Gegensatz zur KI-VO definiert der nationale Reallabore-Gesetz-E den heterogen verwendeten Begriff des Reallabors genauer und verleiht ihm so mehr Kontur. Hiernach ist unter einem Reallabor die „befristete Erprobungen innovativer Technologien, Produkte, Dienstleistungen oder Ansätze, welche unter möglichst realen Bedingungen und unter Beteiligung der jeweils zuständigen Behörde von Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung oder Zivilgesellschaft durchgeführt werden“ zu verstehen (§ 2 Nr. 1 Reallabore-Gesetz-E).
Genehmigt werden solche Reallabore nach behördlichem Ermessen in aller Regel auf Grundlage einer ‚Experimentierklausel‘, die Anforderungen an die Ermessensausübung formuliert. Ein bekanntes Beispiel für eine solche Experimentierklausel ist im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) enthalten.
Experimentierklausel im §2 Absatz 7 Personenbeförderungsgesetz
Zur praktischen Erprobung neuer Verkehrsarten oder Verkehrsmittel kann die Genehmigungsbehörde auf Antrag im Einzelfall Abweichungen von Vorschriften dieses Gesetzes oder von auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Dauer von höchstens fünf Jahren genehmigen, soweit öffentliche Verkehrsinteressen nicht entgegenstehen.
Neben dem Beispiel aus dem PBefG bestehen weitere Experimentierklauseln. Darüber hinaus gilt seit April 2025 für die gesetzgebenden Organe eine Prüfpflicht zur Aufnahme dieser Klauseln in Gesetzentwürfe. Anliegen ist, möglichst weitere Experimentierklauseln für verschiedene Bereiche zu schaffen, die Anforderungen an die Genehmigung von Reallaboren stellen.
Neben den Anforderungen der spezifischen Experimentierklauseln definiert der Reallabore-Gesetz-E weitere Anforderungen, die das Ermessen der Behörde leiten sollen (§ 4 Reallabore-Gesetz-E). Folglich entscheidet die zuständige Behörde über die Genehmigung unter Berücksichtigung definierter Kriterien:
- der Anforderungen an die Ermessensausübung, die in der spezifischen Experimentier- bzw. Erprobungsklausel enthalten sind,
- der Förderung von Innovation und von regulatorischem Lernen,
- der Evaluation des geplanten Reallabors, insbesondere im Hinblick auf dessen Wirkung gerade als Instrument des regulatorischen Lernens und
- der Möglichkeit einer kontinuierlichen Begleitung und Überwachung des Reallabors durch die zuständige Behörde.

Mit diesem gesetzlichen Rahmen für Reallabore soll ein innovationsfreundliches Klima geschaffen werden, das es verschiedensten Akteuren ermöglicht, unter Aufsicht und mit klar definierten Zielen neue Lösungen zu erproben und somit Wissens- sowie Erfahrungsgrundlagen für künftige Regulierungen (regulatorisches Lernen) zu schaffen.
Reallabore-Innovationsportal des BMWE
Auf Grundlage des Reallabore-Gesetz-E soll auch das Reallabore-Innovationsportal des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) seinen Betrieb aufnehmen (§ 3 Reallabore-Gesetz-E). Das Portal befindet sich seit dem 22. Mai 2025 bereits im Pilotbetrieb. Es fungiert als zentrale nationale Anlaufstelle für Beratung, Information, Vernetzung und Wissenstransfer.
Im Fokus des Reallabore-Innovationsportals steht die gezielte Unterstützung all jener, die Reallabore als Instrument zur Erprobung innovativer Technologien, Produkte, Dienstleistungen, Prozesse oder Geschäftsmodelle nutzen möchten. Reallabore können in die Branchen Mobilität, Logistik, eHealth & Gesundheitswirtschaft, eGovernment & moderne Verwaltung, Energie- und Wasserwirtschaft & Klimaschutz, Agrarwirtschaft & Lebensmittel, Kreislaufwirtschaft, Finanzbereich, Stadtentwicklung & Smart Cities sowie Bildungsbereich eingeordnet werden. Die Möglichkeit zu Reallaboren erschöpft sich also nicht mit der Experimentierklausel des PBefG.
Daneben adressiert das Reallabore-Innovationsportal wichtige Fragestellungen im Zusammenhang mit Planung und Durchführung eines Reallabors (z. B. Unterstützungsmaßnahmen und Förderprogramme) und stellt Informationen über sowie Kontakt zu zuständigen Behörden. Darüber hinaus bietet das Portal die Möglichkeit der Vernetzung mit potenziellen Kooperationspartnern und eröffnet nicht zuletzt über die veröffentlichte Liste an Reallaboren die Gelegenheit, für das eigene Vorhaben aus Best-Practice-Ansätzen zu lernen.
Zusammenfassung und Fazit
Die KI-VO eröffnet über das Forschungsprivileg zwar Chancen im Rahmen von F&E-Projekten innovative KI-Technologien zu entwickeln, ohne unmittelbar regulatorischen Hürden zu unterliegen. Allerdings stellen die Erprobung von Hochrisiko-KI-Anwendungen sowie der Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis nach der KI-VO weiterhin eine Herausforderung dar. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sieht die KI-VO die Einrichtung von KI-Reallaboren vor. Diese werden in Deutschland bereits erprobt. Neben dieser Erprobung bestehen mit dem Reallabore-Gesetz-E Bestrebungen durch gesetzliche Regelung einen rechtsverbindlichen Rahmen für Reallabore zu schaffen. Den verschiedenen laufenden (Pilot-)Projekten ist gemein, dass sie zum Ziel haben, Innovationen zu fördern und den Wissenstransfer zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zu unterstützen.
Gerade auch für KMU eröffnen sich durch die vermehrte Schaffung von Experimentierklauseln und dem Reallabore-Gesetz-E vielfältige Vorteile. Hierzu zählt beispielsweise der einfachere Zugang zu behördlicher Begleitung, die zusammen mit dem rechtsverbindlichen Rahmen für mehr Planungssicherheit bei der Umsetzung neuer Ideen in die Praxis sorgt. Das Reallabore-Innovationsportal ergänzt dies, indem es als zentrale Plattform Vernetzungs- und Beratungsangebote bereitstellt, über Fördermöglichkeiten informiert und bereits bestehende Reallabore sichtbar macht. Insgesamt wird eine innovationsfreundliche Infrastruktur geschaffen, die es KMU erleichtert, digitale und nachhaltige Transformationsprozesse aktiv mitzugestalten, den eigenen Innovationsprozess zu beschleunigen und vom regulatorischen Lernen im Rahmen von Reallaboren zu profitieren.
weiterführende Informationen
- Künstliche Intelligenz und Recht. (2025, 27. März). KIR. https://rsw.beck.de/zeitschriften/kir/editorial/2025/03/27/die-ki-verordnung-und-das-forschungsprivileg
- BfDI – Kurzmeldungen – Pilotprojekt KI-Reallabor. (o. D.). BFDI. https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2025/09-KI-Reallabor.html
- Deutscher Bundestag – Rahmenbedingungen für Reallabore sollen verbessert werden. (o. D.). Deutscher Bundestag. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw21-de-reallabore-1075222