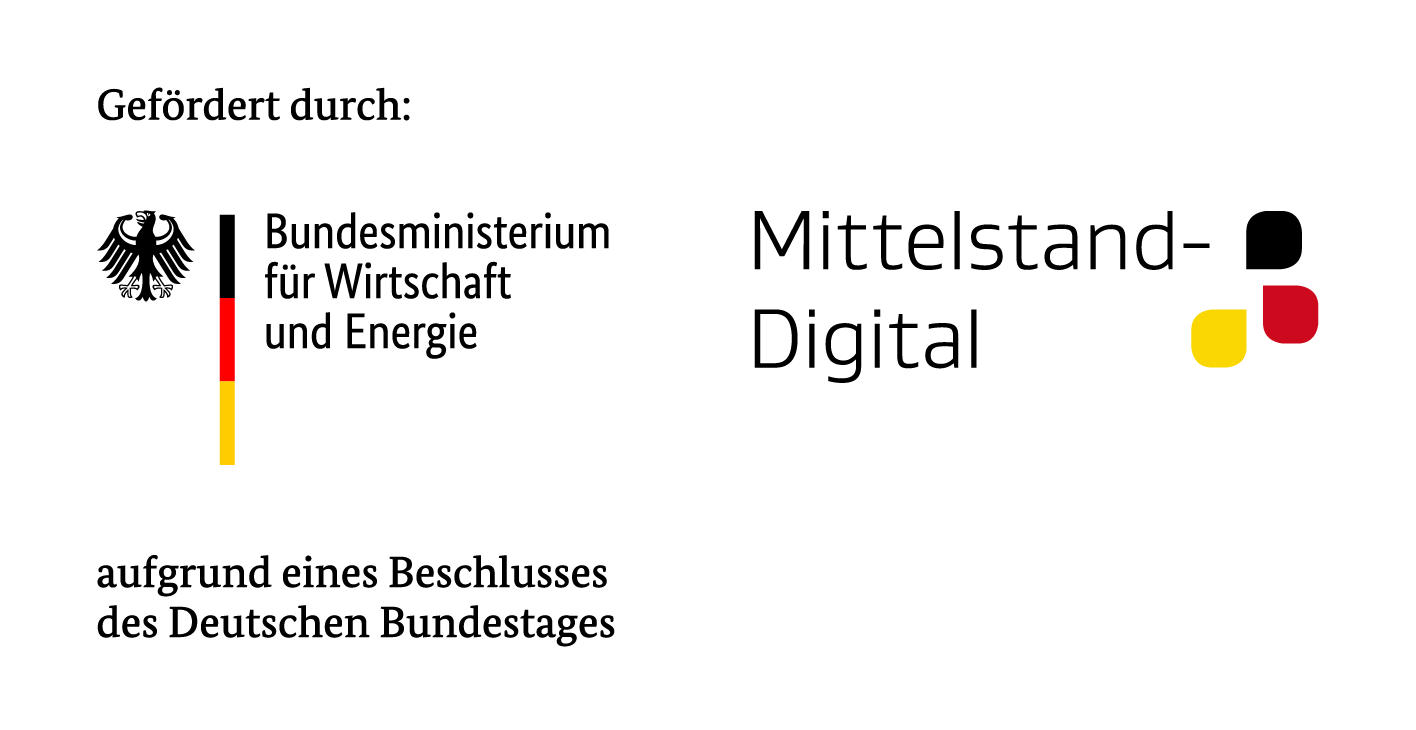Ausgangssituation
Die bisher genutzte IT-Landschaft war geprägt durch eine Vielzahl voneinander unabhängiger Systeme. Es fehlten zentrale Schnittstellen, die einen durchgängigen Informationsfluss ermöglicht hätten. Die Kommunikation innerhalb der Belegschaft erfolgte teilweise über veraltete Medien wie Telefon, Zettelnotizen oder einfache E-Mails. Eine strukturierte Prozesslandschaft lag nicht vor. Die vorhandene Dateiablage basierte auf individuell gewachsenen Explorer-Strukturen mit unklaren Zuständigkeiten und eingeschränkter Auffindbarkeit. Die Stadtwerke Oelsnitz/V. GmbH standen darum vor der Herausforderung, ihre bestehende IT-Infrastruktur grundsätzlich neu auszurichten. Dabei galt es zwischen Open Source Lösungen und Marktführenden Anbietern auszuwählen.
Herausforderung
Eine zentrale Herausforderung lag in der hohen Komplexität der bestehenden Systemlandschaft mit zahlreichen Einzellösungen und fehlenden Schnittstellen. Arbeitsabläufe waren häufig nicht dokumentiert und wurden in den Abteilungen sehr unterschiedlich umgesetzt. Medienbrüche führten zu unnötigen Doppelarbeiten, manuellen Übertragungen und fehlender Nachvollziehbarkeit. Das Auffinden von Informationen gestaltete sich schwierig, insbesondere für neue Mitarbeitende. Ferner wurden bestehende Systeme nur teilweise genutzt, Potenziale blieben so unerschlossen. Gleichzeitig musste berücksichtigt werden, dass das Unternehmen Teil der kritischen Infrastruktur ist und daher besondere Anforderungen an Datenschutz, IT-Sicherheit und Ausfallsicherheit bestehen. Zudem bestand innerhalb der Organisation Unsicherheit darüber, welche Anwendungen in Zukunft weiter genutzt werden können, welche ersetzt werden müssen und wie eine sinnvolle Weiterentwicklung aussehen kann. Die Entscheidung über die zukünftige Basissoftware musste unter Berücksichtigung technischer, organisatorischer und personeller Rahmenbedingungen getroffen werden.
Vorgehen
Zu Beginn des Projekts fand ein Auftaktgespräch mit Vertreterinnen und Vertretern aus allen relevanten Unternehmensbereichen statt. Ziel war es, die Ausgangslage transparent zu erfassen und die Anforderungen an eine zukünftige IT- und Digitalisierungsstrategie zu klären. Die Geschäftsführung, der kaufmännische Leiter, IT-Verantwortliche sowie Mitarbeitende aus dem technischen Bereich, dem Kundenservice und dem Datenschutz nahmen teil. Im Rahmen der Gespräche wurde die bestehende Systemlandschaft analysiert, organisatorische Abläufe nachvollzogen und die bestehende Kommunikations- und Dokumentationspraxis erfasst. Außerdem wurde die Einbindung externer Systeme und Rechenzentren sowie deren Auswirkung auf kritische Geschäftsprozesse besprochen. Es wurden konkrete Schwachstellen erfasst. Darunter fehlende Schnittstellen, parallele Datenablagen und nicht genutzte technische Potenziale. In mehrerer Workshops wurde gemeinsam herausgearbeitet, welche Anforderungen die unterschiedlichen Abteilungen an eine zukunftsfähige IT-Landschaft haben. Ergänzend wurde ein Konzeptvorschlag zur strukturierten Weiterarbeit erstellt, mit Fokus auf der internen Nutzbarkeit und Weiterentwicklung.
Lösung
Als Ergebnis entstand ein gesamtheitliches Konzept zur Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie. Das Unternehmen erhielt eine strukturierte Übersicht über die bestehende IT-Landschaft und die damit verbundenen Schwachstellen. Es wurden konkrete Empfehlungen formuliert, wie eine konsistente und abteilungsübergreifende IT-Struktur mit zentralen Schnittstellen aufgebaut werden kann. Dabei wurde auch festgehalten, welche Systeme perspektivisch weiterentwickelt oder ersetzt werden sollen. Das Konzept wurde so gestaltet, dass es eigenständig durch das Unternehmen weiterverwendet und vertieft werden kann. Dabei wurden auch die bestehenden Rahmenbedingungen der kritischen Infrastruktur berücksichtigt. Im weiteren Verlauf plant das Unternehmen, auf Basis dieses Konzepts weitere Prozessoptimierungen und IT-Maßnahmen eigenständig umzusetzen. Das Projekt diente zugleich als Ausgangspunkt zur Einbindung weiterer Unternehmensbereiche in die digitale Transformation.
Die Zusammenarbeit hat uns geholfen, unsere IT-Strukturen besser zu verstehen und konkrete nächste Schritte zur Digitalisierung gezielt anzugehen. Wir konnten Klarheit gewinnen, wo unsere Herausforderungen liegen und welche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bestehen.
Die Erfahrungen aus dem Projekt will das Unternehmen bei zukünftigen Maßnahmen berücksichtigen und weiterentwickeln.